Edmund Husserl
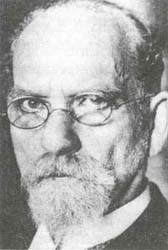
Edmund Husserl
(1859-1938)
wurde am 8. April 1859 in Proßnitz (Mähren) geboren, studierte
zunächst in Leipzig Mathematik, Philosophie, Physik und Astronomie.
Er wechselte 1876 zunächst nach Berlin und anschließend nach
Wien. Hier wurde er, nachdem er bereits mit einer Dissertation in Mathematik
promoviert hatte, durch seinen Lehrer Franz Brentano für die Psychologie
und Philosophie begeistert. 1887 habilitierte er sich in Halle bei Carl
Stumpf mit einer Schrift "Über den Begriff der Zahl. Psychologische
Analysen", in denen die Psychologie als Ausgangspunkt der Mathematik
gesetzt wird.
Bis 1901 blieb er
Privatdozent an der dortigen Universität, an der er schließlich
seine "Logischen Untersuchungen" (1900/1901) verfaßte.
Mit dieser Arbeit entsagte er seiner bisherigen Überzeugung und befreite
sich damit vom Dogma des Psychologismus seiner Zeit. Dessen Bedeutung
hatte sich bisher auf die These gestützt, daß sowohl der Mensch
als auch seine Umwelt sich lediglich durch Empfindungen begreifen lasse.
Husserls Schrift traf indessen den Nerv des neuen Jahrhunderts und führte
schließlich zu einer Abkehr vom Psychologismus, der in seiner fatalen
Entwicklung zu einer Unmöglichkeit allgemeingültiger Aussagen
und damit zu relativistischen und solipsistischen Tendenzen innerhalb
der Forschung geführt hatte.
Die "Logischen
Untersuchungen" bildeten aber auch die Grundlage der von Husserl
entwickelten "phänomenologischen Methode", welche nicht
dem Erkennen des faktischen Seins dienen soll, sondern vielmehr die Natur
und die Gesetzmäßigkeit des Erkennens selbst ergründen
will. Die Phänomenologie ist demnach weniger eine philosophische
Richtung als vielmehr eine wissenschaftliche Verfahrensweise, mit der
jedoch, wie das Wirken seiner Schüler zeigte, die vielfältigsten
Themenbereiche und Fachgebiete durchdrungen werden können. Kategorisch
gefordert wird dabei eine Bewußtmachung alles Subjektiven und Individuellen
während der Betrachtung sowie die kritische Revision hergebrachter
Traditionen und Weltkonstrukte, von denen das Bewußtsein geläutert
werden muß. Erst anschließend sollen die Objekte gesichtet
und auf ihr Wesen hin geprüft werden.
1901 wurde Edmund
Husserl nach Göttingen berufen, fünf Jahre später erhielt
er den Status eines ordentlichen Professors. Schon bald nach seiner Ankunft
sammelte sich eine Schar von begeisterten Schülern aus aller Welt
um ihn, die sich u.a. in der Philosophischen Gesellschaft wie im Göttinger
Phänomenologenkreis zusammenschlossen. Edith Stein schildert in "Aus
dem Leben einer jüdischen Familie":
"Die ‚Logischen
Untersuchungen' hatten vor allem dadurch Eindruck gemacht, daß
sie als eine radikale Abkehr vom kritischen Idealismus kantischer und
neukantischer Prägung erschienen. Man sah darin eine ‚neue
Scholastik', weil der Blick sich vom Subjekt ab - und den Sachen zuwendete:
die Erkenntnis schien wieder ein Empfangen, das von den Dingen sein
Gesetz erhielt, nicht - wie im Kritizismus - ein Bestimmen, das den
Dingen sein Gesetz aufnötigte. Alle jungen Phänomenologen
waren entschiedene Realisten. Die ‚Ideen' aber enthielten einige
Wendungen, die ganz danach klangen, als wollte ihr Meister zum Idealismus
zurücklenken <...> ein Weg, auf dem ihm seine alten Göttinger
Schüler zu seinem Schmerz und ihrem Schmerz nicht folgen konnten."
(Werke, Bd. VII, S. 219f.)
Von seinen Anhängern
enttäuscht, die fast alle ihren eigenen phänomenologischen Weg
einschlugen, wechselte der Lehrer 1916 an die Universität Freiburg
und widmete sich dort seinen Studien, u.a. über die Intersubjektivität.
Verbittert hat ihn schließlich die Tatsache, daß sein ehemaliger
Protegé, Martin Heidegger, sich bald nach der Ernennung zu seinem
offiziellen Nachfolger im Jahre 1928 - menschlich wie inhaltlich - von
ihm abwandte.
Ab 1933 bekam auch
Edmund Husserl, der 1886 vom Judentum zum protestantischen Glauben konvertiert
war, die nationalsozialistische Rassengesetzgebung zu spüren, die
sein öffentliches Wirken fast unterband. Sein Tod am 26.4.1938 blieb
nahezu unbeachtet.
Edith Stein und
Edmund Husserl
Edith Stein war 1913
nach Göttingen gekommen, um den Verfasser der "Logischen Untersuchungen"
kennenzulernen, die einen sehr tiefen Eindruck auf sie gemacht hatten.
Bis zu seinem Tod im Jahre 1938 schätzte sie ihn als einen großen
Intellektuellen, auch wenn ihre menschliche wie berufliche Beziehung schwierig
und für sie in vieler Hinsicht enttäuschend war. Edmund Husserls
Verhältnis zu seiner Schülerin war ambivalent. Zwar erkannte
er ihr wissenschaftliches Talent, doch konnte er seine Vorurteile gegenüber
akademischen Frauen nie überwinden.
Trotz seiner Zusage,
die Note summa cum laude qualifiziere sie zur Habilitation, boykottierte
Husserl alle Bemühungen Edith Steins um eine Hochschullaufbahn an
seiner Seite, selbst, als 1920 Frauen die venia legendi offiziell erteilt
werden durfte. Protegierende Maßnahmen, von denen etwa Roman Ingarden
oder Alexander Koyré profitierten, enthielt er ihr vor. Im Gefühl
tiefer Resignation schreibt sie am 11.11.1919 an Ingarden:
"Indessen
ist meine Arbeit in Göttingen vorschriftsmäßig eingereicht
und sehr unvorschriftsmäßig ohne Prüfung abgewiesen
worden. (...) Daß ich lieber auf die Habilitation verzichte, als
Husserl noch einmal darum angehe, können Sie sich wohl denken."
Schon lange ist jener
hoffnungsvolle Enthusiasmus verflogen, der anklingt, als sie 1916 von
ihrem Lehrer zur ersten weiblichen Hochschulassistentin der Philosophie
in Deutschland ernannt wird. "Ich weiß nicht, wer von uns beiden
glücklicher war. Wir waren wie ein junges Paar im Augenblick der
Verlobung", heißt es in "Aus dem Leben einer jüdischen
Familie". Doch die Arbeit erwies sich schon bald als aufzehrend,
uferlos und höchst undankbar. Am 28.1.1917 schreibt sie an Ingarden:
"Die neueste
Prognose des Meisters für das Werden der Ideen; ich muß zunächst
so lange bei ihm bleiben, bis ich heirate; dann darf ich nur einen Mann
nehmen, der ebenfalls sein Assistent wird und die Kinder desgleichen.
Höchst infaust!"
Schließlich
revoltierte sie. Am 19.2.1918 heißt es in einem Brief an ihren Studienkollegen:
"Im Grunde
ist es der Gedanke, jemandem zur Verfügung zu stehen, den ich nicht
vertragen kann. Ich kann mich in den Dienst einer Sache stellen, und
ich kann einem Menschen allerhand zu Liebe tun, aber im Dienst eines
Menschen stehen, kurz gesagt: gehorchen, das kann ich nicht. Und wenn
Husserl sich nicht wieder daran gewöhnt, mich als Mitarbeiterin
an der Sache zu behandeln - wie ich unser Verhältnis immer angesehen
habe und er in der Theorie auch - so werden wir uns eben trennen müssen."
Noch im selben Jahr
zog sie die Konsequenz und kündigte ihre Stelle, bot dem Lehrer jedoch
weiterhin ihre Hilfe auf privater Basis an. Trotz vieler gescheiterter
Hoffnungen und frustrierender Begebenheiten blieb sie ihrem Lehrer bis
an sein Lebensende in Hochachtung und Freundschaft verbunden.
|
![]()