Historische Wohnorte von bekannten Frauen der Düsseldorfer Kulturszene
Hulda Pankok
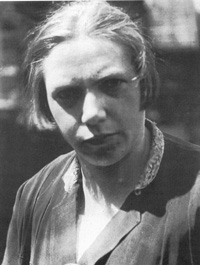 |
Hulda Droste, 1895 in Bochum geboren, kommt 1919 nach Düsseldorf,
um zunächst in der von ihrem Bruder herausgegebenen "Düsseldorfer
Zeitung" und im "Mittag" journalistisch mitzuwirken. Im gleichen
Jahr lernt sie bei Johanna Ey
den Maler Otto Pankok kennen, den sie 1921 heiratet. Nach der Geburt
der Tochter Eva zieht die Familie 1925 in das Haus auf der Brend'amourstr.
65. Hulda Pankok ist weiterhin journalistisch tätig. Neben zahlreichen
Beiträgen in verschiedenen Zeitungen erhält sie 1929 den ersten
Auftrag als freie Mitarbeiterin für den Westdeutschen Rundfunk.
Hulda Pankok über Louise Dumont Text: Ruth Sandhagen (Quelle: Dem Vergessen entgegen. Frauen in der Geistesgeschichte Düsseldorfs. Lebensbilder und Chroniken. Dokumentation einer Ausstellung des Frauen-Kultur-Archivs. Neuss 1989) |
Zurück zum Start Zurück nach oben