Das Exil in Amerika (1940-1950)
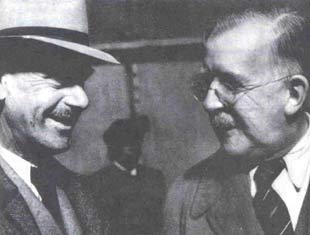
Thomas Mann begrüßt seinen Bruder
in New York,
am 13.10.1940
Am
10. Okt 1940 trifft der griechische Dampfer Nea Hellas
im Hafen von New York ein, wo Thomas Mann wartet, um seinen Bruder in
Empfang zu nehmen. Heinrich und Nelly Mann bleiben bis Anfang November
bei den Verwandten in Princeton.
Die Einreiseerlaubnis Heinrich Manns ist an einen – durch die Vermittlung
des Emergency Rescue Commitees zustande gekommenen – Vertrag mit
der Filmgesellschaft Warner Brothers geknüpft. Hoffnungen der Manns
an der Ostküste ansässig zu werden zerschlagen sich.
Amerikanisches Renommee
„Amerika
kennt mich fast so wenig wie ich es kenne“
Heinrich Mann in einem Brief an Wolfgang Bartsch
vom 3. Feb. 1949
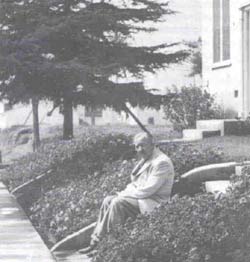
H. Mann in Los Angeles
Die Selbststilisierung als gänzlich auf seine private Existenz zurückgeworfenen
Menschen im fremden Kalifornien erscheint bei näherer Betrachtung
zweifelhaft. Anders als in Frankreich fühlte der Schriftsteller sich
allerdings nun tatsächlich exiliert, es blieb ihm jedoch ein reger
Kontakt mit Feuchtwanger und Brecht.
Vergleichbares lässt sich auch über die Einschätzung, Heinrich
Manns Werk habe in Amerika keine Aufmerksamkeit erfahren, sagen. Publikationen
seiner neueren Prosa scheiterten. Der Schriftsteller besaß bis zuletzt
in Amerika weder einen mit seinem Bruder noch einen mit seinem früheren
Renommee vergleichbaren Bekanntheitsgrad. Er wurde jedoch wiederholt aufgefordert,
Vorworte und Beiträge für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften
zu schreiben, war Mitherausgeber verschiedener Anthologien und an der
Gründung des zweiten Exilverlages Aurora beteiligt.
Mann wurde außerdem „in recognition of his outstanding contribution
to contemporary literature” zum Ehrenmitglied der Eugene Field Society
gewählt, und sein 75. Geburtstag wurde durch Symposien und Artikel
festlich begangen.
Finanzielle Schwierigkeiten
Das amerikanische Exil ist für Heinrich Mann durch Geldknappheit gekennzeichnet. Die sowjetischen Tantiemen erreichen ihn nicht mehr. Nachdem sein Vertrag mit Warner ausläuft, ist das Ehepaar weitgehend auf den Verdienst seiner Frau Nelly als Uniformschneiderin und später als Krankenschwester sowie auf monatliche Zuwendungen Thomas Manns durch den European Film Fund angewiesen.
Privates Unglück
1944 begeht seine zweite Frau Nelly Mann
in Santa Monica Selbstmord. Heinrich Mann schreibt rückblickend an
seinen Freund Félix Bertaux:
„Je le suis absolument depuis la mort de ma femme, advenue le 17
décembre dernier. Je ne vis qu’à demi, et dans une
ombre qui s’épaissit. Ma chère compagne a été
tout pour moi, le passé vivant, les huit années heureuses
de France, ce qui me restait de jeunesse. […] Elle m’a, à
la lettre, aidé de ses bras lors de notre fuite à travers
les Pyrénées. Plus tard elle m’a soutenu dans la vie
difficile de l’exil, du vrai, car en France, ce n’en était
pas un. Quand un femme comme celle-là perd enfin courage et finit
par renoncer à un devoir devenu trop lourd, jugez de ce qui nous
fut destiné. Nous avons payé cher d’être nés
où il ne fallait pas.“
„Völlig vereinsamt bin ich seit dem Tod meiner Frau am 17.
Dezember vergangenen Jahres. Ich lebe nur halb, in sich verdichtendem
Dunkel. Meine teure Gefährtin ist mir alles gewesen, die leibhaftige
Vergangenheit, acht glückliche Jahre in Frankreich, und was mir an
Jugend geblieben war. [...] Sie hat mich buchstäblich an die Hand
genommen bei unserer Flucht durch die Pyrenäen. Später war sie
mir ein Halt in dem schwierigen Leben des Exils, des wirklichen, denn
in Frankreich war es keines. Wenn solch eine Frau am Ende den Mut verliert
und sich schließlich einer allzu schwer gewordenen Aufgabe entzieht,
so zeigt Ihnen das, was uns auferlegt war. Wir haben teuer dafür
bezahlt, am verkehrten Ort geboren zu sein.“
(Brief Heinrich Manns an Félix Bertaux vom 3. April
1945)
Erarbeitung: Christina Szentivanyi |