Finanzielle Not und Vereinsamung im Exil
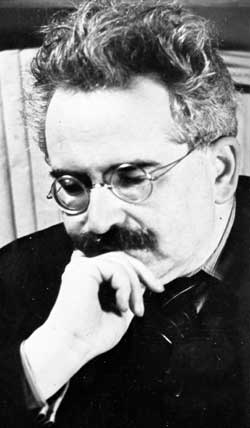
Paris 1939
Die Hauptzeit seines Exils verbrachte Benjamin in Paris, unterbrochen von längeren Aufenthalten in San Remo bei seiner geschiedenen Frau und in Dänemark bei seinem Freund Bertold Brecht. Die Exilzeit war von Anfang an von finanzieller Not geprägt. Am 20.10.1933 schrieb Walter Benjamin an Kitty Marx-Steinschneider:
„Und so würde ich mich
getrost einigen Bemerkungen über Paris zuwenden, wenn sie nur halbwegs
erfreulich ausfallen würden [...].
Ich kam mit einer schweren Malaria an. Das Fieber ist inzwischen überwunden
und die Ermattung, welche sie zurückließ, läßt mich
genau die Kraft der trostlosen Lage inne zu werden, doch keineswegs die,
sie zu überwinden, indem ich nicht einmal die Treppenstufen der billigen
Hotels ersteigen kann in denen ich mein Unterkommen wählen muß.
Was von Juden und für Juden hier geschieht, kann man vielleicht am
besten als fahrlässige Wohltätigkeit bezeichnen. Es verbindet
mit der Perspektive auf Almosen – die selten eingelöst werden
– das Höchstmaß an Demütigungen [...] Deutsche zu
sehen vermeide ich. Lieber spreche ich noch mit Franzosen, die zwar kaum
etwas tun können oder mögen, aber die große Annehmlichkeiten
haben, einem nicht ihre Schicksale zu erzählen.“
Benjamin lebte nicht nur ökonomisch
am sozialen Minimum, auch fehlten ihm jene intellektuellen Gespräche
und Diskussionen mit seinen engsten Freunden, was zu einer umfangreichen
„Exilkorrespondenz“ führte, die jedoch auch das immer
öfter auftauchende Wort „Vereinsamung“ nicht änderte,
genauso wenig, wie seine gelegentlichen Besuche bei Brecht in Dänemark
oder seiner Familie in San Remo. Am 11.01.1940 schreibt Brecht an Gershom
Scholem:
„Die Vereinsamung, in der ich mich von Haus aus finde, ist durch
die Zeitumstände gewachsen. Der Rest von Verstand, der den Juden,
nach allem was sie durchgemacht haben, noch geblieben ist, scheint ihnen
locker zu sitzen. Die Zahl derer, die sich auf dieser Welt zurechtfinden,
schmilzt mehr und mehr.“
Bis Mitte der Dreißiger Jahre war es Benjamin noch möglich, unter Pseudonymen in Deutschland zu publizieren. Jedoch waren die meisten seiner Veröffentlichungen bloße Gelegenheitspublikationen. Die einzige beständige Einnahmequelle im Exil für ihn war die „Zeitschrift für Sozialforschung“, das Publikationsorgan des Instituts für Sozialforschung. 1933 war dieses rechtzeitig von Frankfurt nach Genf und ein Jahr darauf nach New York emigriert.
Mit dem Herausgeber Max Horkheimer stand Benjamin dadurch in engem Kontakt, aber auch direkter finanzieller Abhängigkeit. So erschien in der Zeitschrift nie ein unrezensierter Artikel Benjamins. Politisch konnte er sich also kaum entfalten. Ein Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung war auch sein enger Vertrauter und Freund Theodor W. Adorno. Trotz der Initiative Adornos und Horkheimers gelang Benjamin nicht mehr die Übersiedlung in die USA, zu der er sich nach langem Zögern entschloss.
Erarbeitung: Ute Grasshoff, Ruth Sandhagen |